Alles aus ‘Interview’
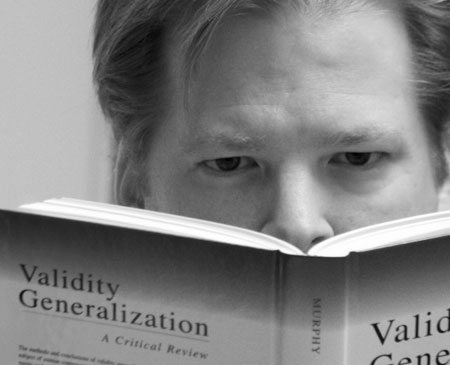
Psycho-Spiel
Sind wir wirklich so berechenbar, dass Videospiele unsere Psyche beeinflussen können? Der promovierte Psychologe und leidenschaftliche Gamer Jamie Madigan erklärt in seinem Blog psychologyofgames.com, wie eng Psychologie und Videospiele zusammenhängen. Dabei verzichtet er auf Fachsprache und verpackt wissenschaftliche Zusammenhänge in Anekdoten und cleveren Beispielen. Im Interview erzählt Jamie Madigan, wie und warum Gamedesigner den Spieler manipulieren.
Mr. Madigan, was ist so spannend am Zusammenhang zwischen der Videospiel-Welt und der Wissenschaft der Psychologie?
Eines meiner Lieblingsbeispiele ist ein Phänomen namens Verlustaversion: Die menschliche Psyche wird durch Verluste schwerer belastet, als durch Gewinne – selbst wenn der Wert derselbe ist. Ein einfaches Beispiel: Der Schmerz, fünf Euro zu verlieren, ist größer, als die Freude, fünf Euro zu bekommen. Deshalb kombinieren wir Verluste, um sie besser akzeptieren zu können. Gewinne hingegen brechen wir gerne in viele kleine Errungenschaften auf.
Das ist der Grund, warum wir im Multiplayer der „Call of Duty" Spiele häufige, aber kleine Belohnungen erhalten. Auch bei Level-Ups in Rollenspielen bekommen wir meist mehrere Belohnungen.
Das heißt also, Entwickler wenden ganz bewusst „psychologische Tricks“ an, um den Spieler zu manipulieren?
Ja, ständig. Wenn ich für meinen Blog Entwickler kontaktiere, höre ich einen Satz immer wieder: „Ich wusste, dass dieses Zeug funktioniert, aber ich hatte keine Ahnung, dass es dafür sogar einen Namen gibt.“
Das beudetet natürlich nicht, dass die Manipulation von Gamern etwas Schlechtes ist. Wenn es nicht gerade die Leute sind, die Farmville machen, wollen die meisten Designer ihre Spiele mit solchen Tricks nur unterhaltsamer machen.
Wie kamen Sie ursprünglich auf die Idee, zwei so unterschiedliche Themen in einem Blog zu verbinden?
Jedes Jahr starte ich ein neues Blog-Projekt und während ich überlegte, was ich 2010 machen könnte, stieß ich in Fachzeitschriften und Büchern immer wieder auf Texte, die Gamer-Verhalten und Gamedesign-Entscheidungen erklärten. Das fand ich total spannend und weil ich mich sowohl mit Psychologie, als auch mit Videospielen auskenne, setzte ich mich hin, fing an zu tippen – und bis heute gehen mir nicht die Ideen aus.
Gibt es Spiele, die Sie ganz besonders zum bloggen motiviert haben?
Da fällt mir als erstes „Dragon Age" ein. Beim Spielen haben mich wieder einmal die Romanzen beeindruckt, die Bioware seinen Charakteren auf den Leib schreibt. Das führte dann dazu, dass ich einen Blog-Post über unsere psychologische Reaktion auf vertane Chancen in diesen Beziehungen schrieb.

„Lebendigste Kriegserfahrung”
128 europäische Journalisten im Online-Duell gegen 128 amerikanische Journalisten. Auf einer Karte! „MAG” setzt voll auf gigantische Massenschlachten, bei denen verschiedene Missionsziele, wie Reparaturen oder Sabotage, erfüllt werden müssen. Spieler können sich einer von drei Söldnerarmeen anschließen und durch Erfahrungspunkte neue Fähigkeiten freispielen. Damit bei einer derartigen Spielerschar nicht der Überblick verloren geht, können einzelne Spieler Kommandoposten übernehmen und ihren Mitstreitern Befehle erteilen. In London konnten wir den Online-Shooter erstmals anspielen. Abseits des Schlachtengetümmels haben wir uns mit Ben Jones über das Chaos im Schützengraben unterhalten. Der 28-Jährige ist Designer bei Entwickler Zipper Interactive.
Hallo Ben, was genau ist „MAG”?
„MAG” steht für Massive Action Game und ist das Ergebnis unserer Erfahrung als Spieledesigner der „SOCOM”-Reihe und der intensiven Beschäftigung mit Netzwerktechnologien. Es ist das größte Schlachtfeld, das man je auf einer Konsole erkunden konnten. Mit 256 Spielern in einer Partie, einem Rangsystem, das die Kämpfe koordiniert und abwechslungsreichen Missionszielen haben wir die lebendigste Kriegserfahrung geschaffen, die du auf einer Konsole finden kannst.
Ihr habt ziemlich harte Konkurrenz im Multiplayer-Krieg. Was kann „MAG“ Titeln wie „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und den kommenden Shootern „Battlefield: Bad Company 2“ oder „Medal of Honor“ entgegensetzen?
„MAG” macht viele Dinge anders als die typischen Vertreter des Ego-Shooter-Genre. Von Beginn an haben wir den Fokus komplett auf den Multiplayer-Aspekt des Spiels gesetzt. Wir versuchen nicht auf die Schnelle eine lieblose Einzelspielerkampagne in das Game hereinzufrickeln. Gigantische Online-Duelle waren alles was uns interessiert hat. Die wirst du so auch nicht in einem der anderen Titel sehen. Außerdem war uns die Idee einer Kommandostruktur wichtig, durch die die Kämpfe sehr strategisch werden. Die Gefechte entscheiden zudem, welche der drei Spielparteien im weltweiten Ranking welchen Platz einnimmt. Die Spieler werden also jedes mal die direkte Konsequenz ihres Abschneidens auf dem Schlachtfeld sehen können.
Wie wirkt sich das Abschneiden der einzelnen Parteien genau auf folgende Matches aus?
Es gibt drei Spieltypen: Sabotage für 64, Acquisition für 128 und Domination für 256 Spieler. Jeder dieser Modi hat als Belohnung für ein gewonnenes Match einen sogenannten Vertrag. Diese Verträge geben den Spielparteien Boni, wie verkürzte Respawnzeiten, Luftschläge, oder mehr Erfahrungspunkte für Ingame-Aktionen wie Abschüsse und das Heilen eines Kameraden.
Wird es neben individuellen Achievements auch Erfolge für eine feste Gruppierung von Spielern geben, die ständig zusammen spielen?
Wir wollten vermeiden, dass Spieler gezwungen sind einem Clan beizutreten, um bestimmte Fähigkeiten zu erhalten. Darüber stolpern viele Games, in denen man High-Level-Inhalte nur zu Gesicht bekommt, wenn man in einer festen Gruppierung unterwegs ist. Trotzdem war uns der Communityaspekt sehr wichtig. Darum sind viele der Achievements die man bekommt nur im Zusammenspiel mit anderen nützlich. Du spielst sie alleine frei, nutzt sie aber um dein Team voran zu bringen.
Während des Spielens ist mir aufgefallen, dass auf den Maps ein riesiges Chaos herrschte. Der Teamplay-Aspekt wurde übergangen, viele Spieler liefen alleine los und kümmerten sich nicht um Verwundete. Wie wollt ihr erreichen, dass Spieler tatsächlich gemeinsam vorgehen?
„MAG” beginnt mit einfachen Trainingsmissionen, die die Spieler langsam an die vielen Möglichkeiten des Teamplays heranführen, statt sie sofort mit 255 anderen Leuten auf eine Map zu werfen. Durch die Unterteilung in kleine Einheiten á 8 Personen und deren Aufteilung in größere Gefechtseinheiten wird die Vorgehensweise schon übersichtlicher. Die Missionsziele der kleinen Einheiten sind simpel, die Planung der Gesamtstrategie ist komplex. Daher empfehlen sich die höheren Ränge auch eher für erfahrene Spieler. „MAG” verlangt aber tatsächlich etwas Einarbeitungszeit, um sein volles Potential zu entfalten.
Welche Pläne habt ihr zum Aufbau einer Community? Ohne eine geeignete Plattform zum Austausch könnten Spieler von „MAG” schlicht überfordert sein.
Für diesen Zweck haben wir www.mag.com eingerichtet. Die Seite soll ein Knotenpunkt werden, über den du Mitstreiter finden kannst und dich mit ihnen über das Spiel austauschen kannst. Außerdem gibt es im Spiel die Option Leute von deiner Freundesliste zu finden und ihrem Spiel beizutreten, so dass du sicher gehen kannst, nicht bei jeder Partie bei Null anzufangen.
Erzähl doch etwas zu den technischen Aspekten des Spiels. Wie schafft ihr es, dass die Matches flüssig laufen, wenn dermaßen viele Spieler auf einer Karte unterwegs sind?
Für jeden Spieler werden die Details der Umwelt individuell berechnet. Wenn du auf der einen Seite einer Karte stehst, ist es nicht nötig, die Häuser, Charaktere und Fahrzeuge der anderen Seite in allen Einzelheiten in deinen Speicher zu pumpen. Dadurch sparen wir Prozessor-Ressourcen und können ein flüssiges Spiel ermöglichen. Natürlich ist das ganze im Detail noch eine Spur komplexer, aber wir wollen ja nicht zu technisch werden.

„Die Welt erklären“
In unserer seit heute erhältlichen Jubiläumsausgabe lest ihr ein Exklusiv-Interview mit „Deus Ex“-Erfinder Warren Spector. Darin spricht er ausführlich über sein neues Projekt „Epic Mickey“ und erinnert sich an seine Anfänge als Journalist für das Videospielmagazin „Space Gamer“. Für seine folgende Abrechnung mit dem derzeitigen Stand des Spielejournalismus war im Heft leider kein Platz mehr:
„Ich denke, die Qualität des Videospieljournalismus könnte besser sein. Ich würde mich zum Beispiel über gründlichere Recherche freuen. Und leider gibt es nur wenige Magazine, die unter die Oberfläche blicken und sich mit der Geschichte und der tieferen Bedeutung von Games auseinandersetzen. Es müsste mehr drin sein als „Dieses Spiel bekommt sieben von zehn Punkten“ oder „Hier ist das neueste Zitat von Videospielgott Will Wright“. Und Videospielzeitschriften sollten sich nicht nur an Stammkunden richten, sondern auch daran interessiert sein, einem breiteren Publikum die Welt der Videospiele zu erklären. Aber der Spagat zwischen der Zielgruppe der Hardcore- und der Mainstreamgamer ist natürlich schwierig. Nicht ohne Grund gibt es „Space Gamer“, das Magazin, an dem ich damals mitgewirkt habe, schon lange nicht mehr.“
Zu hart geurteilt? Oder nicht hart genug? Sagt uns, wie ihr die derzeitige Lage des Spielejournalismus einschätzt. Was stört euch, was läuft eigentlich ganz gut, und was geht überhaupt nicht?

Taktik und Seele
Wir waren in Moskau, um mit Spielentwicklern aus der ehemaligen UdSSR über die dortigen Arbeitsbedingungen und eigenwillige Ansätze im Game Design zu sprechen. Den Bericht lest ihr in der neuen GEE, die ab Montag am Kiosk liegt. Exklusiv auf geemag.de erzählt Videospielproduzent Wolfang Walk, 48, von seinen Erfahrungen mit dem Moskauer Entwicklerstudio Ice-Pick Lodge und den Besonderheiten des russischen Marktes
Herr Walk, Sie haben die europäische Fassung von „The Void“, einem Kunst-Spiel des Moskauer Studios Ice-Pick Lodge produziert. Wie verlief die erste Begegnung mit den Entwicklern?
Nikolay Dybowskiy, der kreative Kopf hinter „The Void“ hat mich bei meinem ersten Besuch in Moskau zuerst ins Museum geschleift, um mir einige seiner Lieblingsbilder zu zeigen und zu sehen, wie ich auf diese reagiere. Das war wie eine Art Aufnahmeprüfung. Ich hatte das starke Gefühl: Jetzt wirst du getestet. Offenbar habe ich bestanden, denn unsere Zusammenarbeit lief sehr gut. Ich war nicht der eiskalte Produzent aus dem Westen, der ihr Spiel komplett umprogrammiert, um es markttauglich zu machen. Wir werden auch in Zukunft zusammenarbeiten.
Dennoch haben Sie ein halbes Jahr an der Übersetzung des Spiels und den Änderungen im Gameplay gearbeitet.
Es musste etwas verändert werden, weil „The Void“ zu Anfang gar kein Spiel war. In den ersten 40 Minuten musste der Spieler zweimal klicken, das war alles an Interaktion. Und auch die Spielmechanik, die danach kam, hat Probleme bereitet. Das Spiel war unheimlich schwer, und viele Dinge ließen sich nur sehr umständlich handhaben. Man musste viermal mit der Maus etwas machen, was man genauso gut mit einem Mausklick erledigen könnte. In diesem Punkt war man meinen Änderungswünschen gegenüber sehr offen. Am Ende fanden die Jungs von Ice-Pick Lodge das Spiel nach meiner Bearbeitung auch besser als vorher.
Im Interview (GEE 47) betonen Nikolay Dybowskiy und Alexsey Luchin von Ice-Pick Lodge, wie wichtig es ihnen ist, dass ein Spiel den Spieler durch eine Art Initiationsritus führt.
Vor allem Luchin vertritt diese Haltung. Es steckt tief in dem russischen Verständnis eines Spiels, dass es nicht einfach sein darf. Ein Spiel muss einen an die eigenen Grenzen bringen, und ein Spiel muss man auch verlieren können. Für die ist Schach, was für uns Tic Tac Toe ist.
In Deutschland gab es diese Haltung auch. Das hat sich aber gelegt. Hierzulande produzierte Spiele werden immer einfacher. Dybowskiy hingegen geht es weniger um den Schwierigkeitsgrad. Er ist mehr daran interessiert, dass ein Spiel eine Erfahrung, ein Erlebnis bietet, dass der Spieler vorher noch nicht erlebt hat. Wenn es den Spieler nicht verändert, ist es eine Zeitverschwendung. Als man mir die russische Fassung von „The Void“ zum ersten Mal gezeigt hat, wusste ich schon beim ersten Bild: So etwas hast du noch nie gesehen. Und wenn du die Fähigkeit besitzt, den Menschen etwas zu zeigen, was sie noch nicht kennen, ist das auch auf dem internationalen Markt Gold wert.
Immerhin hat sich auch die schwerere Original-Version von „The Void“ in Russland rund 50 000 Mal verkauft. Warum mag man im Osten schwere Spiele so gerne?
Viele Menschen in den ehemaligen Ostblockstaaten langweilen sich intellektuell. Sie suchen nach Herausforderungen und Tiefe. Auch in Computerspielen. In Russland liebt man Videospiele mit Taktik und Seele. Der Begriff „intellektuelle Tiefe“ ist noch nicht so in den Verruf gekommen. Ein kluger und weiser Mann gilt in Russland mehr als bei uns im Westen.
Wie beurteilen Sie die Situation der russischen Videospielindustrie?
An Talent und Anspruch mangelt es dort auf keinen Fall. Entwickler in Russland sind qualifiziert, bereit hart zu arbeiten und zu lernen. Die Jungs von Ice-Pick Lodge haben sich nicht weniger zum Ziel gesetzt, als die russische Videospielästhetik zu definieren. Und sie sind auf einem guten Weg, wie ich finde. Das fundamentale Problem des russischen Videospielmarktes ist jedoch das Verhältnis zwischen den Entwicklern und den russischen Publishern. Letztere betrachten die Entwickler mehr oder weniger als Arbeitssklaven. Als Leute, die für möglichst wenig Geld Inhalte zu liefern haben, wobei auf deren Qualität so gut wie gar nicht geachtet wird. Und der russische Markt erlaubt das zurzeit leider auch noch. Das ist verheerend. Wenn man sich vor Augen führt, unter welchen Bedingungen „The Void“ entstanden ist, bekommt man Hochachtung vor den Jungs. Lange Zeit saßen sie in einem Kellerloch ohne Fenster, in einem 15 qm-Raum mit acht bis zehn Leuten. Zudem war das noch ein Durchgangszimmer, durch das ständig Mitarbeiter einer anderen Firma liefen. Trotzdem gehen die Entwickler im Osten immer wieder Geschäfte mit östlichen Publishern ein, weil sie hoffen, dass jemand aus dem Westen so auf sie aufmerksam wird, ihr Spiel herausbringt und es dadurch zu einem weltweiten Erfolg wird.

„Irgendjemand muss es machen“
In unserem neuen Heft beschäftigen wir uns auf verschiedene Arten mit der Zukunft der Videospiele. Wohin geht für Dich die Reise?
Wenn Leute in vielen Jahren auf die Geschichte der Games zurückblicken, wird 2009 als ein Schlüsseljahr erscheinen. Das Bewegungsinterface „Natal“ kommt. Das ist ein enorm großer Schritt in Richtung Zukunft. Das sage ich nicht, weil ich für den „Natal“ Hersteller Microsoft arbeite, sondern als Entwickler: Ich kann nun Charaktere erschaffen, die Dich als Spieler treffen können, die sich mit Dir unterhalten können. Das hat es in der Mediengschichte seit Geschichtenerzählen aus Stammeskulturen vor Tausenden von Jahren nicht mehr gegeben. Vergesst bei „Natal“ Genres wie Rollenspiele oder Minigames. Das ist etwas ganz Neues.
Welche Rolle spielt Innovation bei Deiner Arbeit?
Mein Studio Lionhead steht für Innovation. Ich möchte, dass der Spieler immer das Unerwartete erwartet. Ich verwende mein ganzes Leben darauf, vorgefertigte Haltungen über Games einzureißen. Mich regt es zum Beispiel wahnsinnig auf, wenn Leute an ein Spiel wie „Fable“ rangehen und glauben, schon vorher zu wissen, was sie erwartet. Ich hasse das. Innovation ist gleichzeitig aber unglaublich riskant und anstrengend. In ruhigen Momenten frage ich mich manchmal, ob diese Pein, Berge zu erklimmen, die noch nie jemand erklommen hat, es überhaupt wert ist. Aber irgendjemand muss es machen.
Welchen Berg hättest du im Nachhinein am liebsten nicht erklommen?
Ich war früher als Entwickler wie ein Kind. Ich habe voller Übereifer Feature über Feature in Spiele wie „The Movies“ oder „Black & White“ eingebaut, so dass die Spiele am Ende quasi unspielbar wurden. Beim ersten „Fable“ habe ich im Vorfeld über die Innovationen des Spiels derart viel geredet, dass das Spiel am Ende nur enttäuschen konnte. Das war unglaublich bescheuert von mir. Einer von euch Journalisten hätte mir einfach eine reinhauen sollen und sagen: „Hör endlich auf zu schwafeln, Peter.“
Mehr über „Natal“ und die Zukunft der Videospiele gibt es in der neuen GEE, die ab kommenden Montag im Handel erhältlich ist.

„Mein Gott, was wäre wenn“
Im Zuge unserer Recherche für das große Special über die Zukunft der Videospiele in der neuen GEE-Ausgabe, die am kommenden Montag erscheint, sprachen wir mit Michael Iwoleit. Als Autor von Romanen und Mitherausgeber des Science-Fiction-Magazins „Nova" ist er ein ausgewiesener Experte in Zukunftsfragen. „Nova" veröffentlicht hauptsächlich Storys zeitgenössischer, deutschsprachiger SF-Autoren, daneben Übersetzungen ausländischer Texte, gelegentliche Klassiker-Nachdrucke und Artikel zu artverwandten Themen. Zur Zeit arbeitet Iwoleit an seinem Roman „Toplevel".
In gewisser Weise hat die von der Science Fiction prognostizierte Zukunft längst begonnen. Ist das nicht ein Dilemma für einen Science-Fiction-Autoren?
In der Tat. Den heutigen Science Fiction Schaffenden fällt es immer schwerer, auf Ideen zu kommen, die überhaupt noch wie Science Fiction wirken. Damit meine ich Ideen, die den spezifischen Überraschungs- und Verfremdungseffekt haben, ohne den es Science Fiction nicht geben kann. Die technische Entwicklung hat sich ungemein beschleunigt. Die immer raschere Aufeinanderfolge technologischer Neuerungen, die gestern noch unmöglich waren, ist heute eine Alltagserfahrung. Szenarien, die vor zwanzig Jahren noch wie pure Science Fiction wirkten wie Gentechnik oder Klimawandel, sind Wirklichkeit geworden. Deshalb ist der erfolgreichste Trend in der Science Fiction-Literatur der letzten 15 Jahre die Renaissance eines eigentlich veralteten Subgenres, nämlich der Space Opera, also des großformatigen Weltraumabenteuers.
Warum ist es denn so schwierig, in der Science Fiction noch neue, glaubwürdige Geschichten zu erfinden?
Nehmen wir das Konzept des Cyberspace, eines der großen Themen in der Science Fiction der letzten 25 Jahre. Was mich an Büchern wie etwa Gibsons „Neuromancer"-Trilogie immer gestört hat, ist der Umstand, dass solche Ideen in einer Erzählung leicht in etwas ausarten, was ich als „Anything-Goes"-Szenario bezeichnen möchte: wenn alle Wendungen der Handlung durch technische Gimmicks erklärt werden können, wenn der Autor in entscheidenden Szenen immer ein überraschendes Cyberspace-Kaninchen aus dem Hut ziehen kann, dann gibt es auch keine echte Geschichte, keine überzeugenden Konflikte mehr.
Was also tun, wenn nicht ein Gimmick aus der Zukunft aus dem Hut zaubern?
Wesentlich interessanter finde ich die Technik, die in der Forschung unter dem Stichwort „Augmented Reality" firmiert und in der Science Fiction noch stiefmütterlich behandelt wird. Unter „Augmented Reality" verstehen Wissenschaftler die Überlagerung der Wirklichkeit durch computergenerierte Bilder. Im einfachsten Fall könnte das so aussehen, dass ein User, wenn er ein entsprechendes Sichtgerät aufgesetzt hat, Informationen zu Gegenständen seiner Umgebung, etwa Gebrauchsanleitungen, eingeblendet bekommt. Bei komplexeren Anwendungen, zum Beispiel für Videospiele, könnten Teile seiner Umgebung durch detailgetreue, animierte Grafiken ersetzt werden. Diese Verschränkung von realen und künstlichen Bildern ist in allen möglichen Abstufungen denkbar.
Welche Rolle spielt „Augmented Reality“ in Deinen Werken?
In dem Roman „Wachablösung", an dem ich seit mehreren Jahren arbeite, spielt dieses Konzept eine zentrale Rolle. In diesem Buch werden Spieler, die sich in einen entsprechenden Server einloggen, in die virtuelle Welt eines Spiels versetzt, indem Teile ihrer Umgebung durch Kulissen des Spiels überlagert werden. Ihre Bewegungen und Handlungen, sogar ihre sprachlichen Äußerungen, werden von dem „Augmented Reality"-System zu Elementen des Spiels. Mit jedem Level des Games werden größere Teile der Realität überblendet, bis hin zur Ersetzung der gesamten Alltagsrealität des Spielers.
(mehr …)
